Die Natur bietet uns faszinierende Beispiele für Selbstorganisation: Ein Vogelschwarm bildet komplexe Formationen ohne zentrale Steuerung. Ein Wald organisiert sich als Ökosystem mit erstaunlicher Anpassungsfähigkeit. Ameisen bauen hochkomplexe Staaten ohne hierarchische Planungsstäbe. Jede einzelne Zelle ist ein Kosmos von Millionen ohne zentrale Planung interagierender Moleküle. Diese natürlichen Systeme folgen Grundregeln, die zu erstaunlicher Komplexität und Anpassungsfähigkeit führen. Sie sind weder chaotisch noch starr kontrolliert – sie sind selbstorganisiert.
Interessanterweise finden wir ähnliche Prinzipien in der kirchlichen Tradition: Die frühe Kirche entwickelte sich organisch ohne zentrale Planung. Die Charismen, von denen Paulus spricht, entfalten sich in gegenseitiger Ergänzung zum Wohl des Ganzen. Die ersten Benediktinerklöster folgten dem Prinzip „ora et labora“ als einfache Grundregel, die vielfältiges Leben in unterschiedlichen Kontexten ermöglichte. Immer wieder zeigte sich in der Kirchengeschichte: Wo Menschen auf Gottes Wort hören und auf die Zeichen der Zeit achten, entstehen oft mehr Weisheit und Früchte des Evangeliums als durch zentralisierte Planung.
Da angesichts der komplexen Realität kirchlicher Organisationen Abschied von totalen (und damit leicht totalitären) Planbarkeitsidealen genommen werden muss, bietet das Phänomen der Selbstorganisation und dessen gezielte Förderung somit eine konstruktive alternative Möglichkeit zur Weiterentwicklung einer Organisation, vor allem bei Konflikten und Richtungsdebatten. Das Vertrauen, dass Konflikte nicht nur negativ sind, sondern einen positiven Effekt auf die individuelle und organisationale Lernfähigkeit haben können, können beitragen, dass die Form der Konfliktbewältigung zugleich Ausdruck der jeweiligen Organisationskultur mit ihren Werten und Normen sein kann.
Konflikte entzünden sich häufig an Unterschieden bzw. Widersprüchen. Seit der aristotelischen Logik („Es ist unmöglich, dass jemand annimmt, dasselbe sei und sei nicht“) findet sich diese Logik auch im Alltag: Von zwei sich widersprechenden Aussagen muss mindestens eine falsch sein! Widersprüche gelten als Störungen und sind daher möglichst zu vermeiden. Entweder habe ich recht oder du. Einer gewinnt, der andere verliert. Logisch, dass in hierarchisch strukturierten Organisationen, die ja komplexitätsreduzierend wirken sollen, Personen und Initiativen, die das Bestehende hinterfragen und kritisieren, leicht als Querulant:innen diskreditiert werden.
Die Frage ist, unter welchen Bedingungen Konflikte und Widersprüche sinnvoll, evtl. sogar notwendig sind, um die organisationale Lernfähigkeit zu bewahren. Widersprüche machen zum einen deutlich, dass der Wunsch nach Widerspruchsfreiheit und Harmonie bereits in sich widersprüchlich ist angesichts der dramatischen Veränderungsprozesse, denen heute alle personalen und sozialen Systeme unterliegen. Widersprüche können helfen, die Ordnung wieder bewusst zu machen, das Eigentliche wieder zu finden, die internen Abhängigkeiten einzelner Organisationsbereiche und die damit verbundenen Aporien wahrnehmbar und damit gestaltbar zu machen. Dann wird deutlich, dass Widerspruch und Ordnung nicht automatisch Gegner sein müssen.
Das Problem liegt an der mentalen Verankerung von Ordnung als hierarchisch begründete und damit unumstößliche Wahrheit. Das erschwert die Sichtweise von Ordnung als Selbstorganisation oder sogar als Chaos. Möglich wird das aber, wenn man von einem trivialen Organisationsverständnis zu einem nichttrivialen, komplexen, wechselt. Chaos hat zwar eine bedrohliche Konnotation, allerdings sind chaotische Zustände nicht langwährend, sondern markieren in der Regel den Übergang von einer Ordnung in eine andere, weil die ursprüngliche in eine Krise geraten bzw. „gekippt“ ist. Chaotisches enthält plötzlich auch das Moment des Kreativen, des Schöpferischen und der Erneuerung.
 Georg Plank·Vor 2 Tagen ·3 min. Lesedauer
Georg Plank·Vor 2 Tagen ·3 min. Lesedauer 

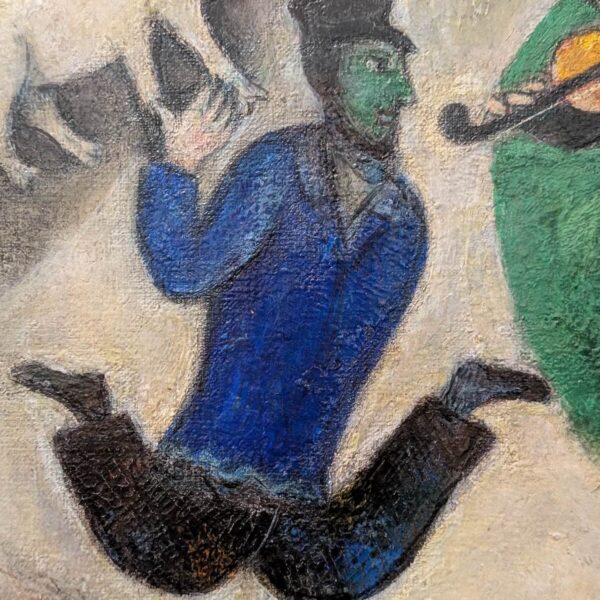

Schreibe einen Kommentar